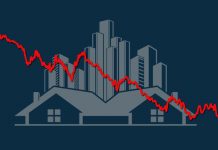Eine Bankenkrise können Notenbanken derzeit nicht gebrauchen. Denn die Retter der letzten eineinhalb Jahrzehnte sind mit der Bekämpfung der Inflation bereits voll ausgelastet. Jedoch schossen sie zuletzt so viel Geld ins System, dass sich Risse auftun.
von Volkswirt Henning Vöpel
Nicht einmal fünfzehn Jahre nach der globalen Finanzkrise von 2008 kommt es erneut zu Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten. Vor einigen Wochen fing es mit der Pleite der Silicon Valley Bank an. Was dann passierte, folgte dem von früheren Krisen bekannten Muster: Nachdem die Märkte den ersten Schock verarbeitet und sich wieder beruhigt hatten, flammte die Krise wenige Tage später erneut auf, als die nächste schlechte Nachricht nun im Lichte der ersten als untrügliches Zeichen für ernstere Probleme im Bankensektor gedeutet wurde: die Credit Suisse war in Schieflage geraten.
Die befürchtete globale Ansteckung wurde mit der Übernahme durch die UBS zunächst einmal abgewendet. Im Gegenzug ist aber ein Bankenriese entstanden, für den zukünftig nicht nur „too big to fail“ gelten könnte, sondern auch „too big to be saved.“
Notenbanken vollführen Kehrtwende
Der Wind drehte plötzlich und hart: Mit der akut steigenden Inflation kam die scharfe Zinswende und die Banken wurden nach Jahren der geldpolitischen Intensivstation in die nun plötzlich sehr rau gewordene makroökonomische Wirklichkeit geschickt. Die gleichzeitige Bekämpfung von Inflation und drohender Finanzkrise ist zwar – wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde zurecht betont – grundsätzlich kein Widerspruch.
Und doch haben sich die Zentralbanken, unter tätiger Mithilfe der in den vielen Krisen äußerst spendablen Regierungen, in eine Falle manövriert, oder wie Daniela Gabor es formuliert: in Zugzwang gebracht – eine Konstellation, die aus dem Schach bekannt ist und eine Situation beschreibt, in der man, obgleich am Zug, seine Stellung nur verschlechtern kann.
Niedrige Zinsen treiben Banken ins Risiko
Und genau dort sind wir jetzt: Die lange Niedrigzinspolitik hat Banken bewusst ins Risiko geführt, Staatsschulden günstig refinanziert und die produktive Erneuerung der Realwirtschaft unterdrückt, indem sie den Anschein erweckte, als würden die Zentralbanken die Garantie dafür übernehmen, dass das, was eigentlich ein gigantisches geldpolitisches Experiment war, auf ewig gut ginge: eine Geldpolitik ohne Zielkonflikte. Nun kehrt die Inflation zurück, und sie ist gekommen, um zu bleiben. „Higher for longer“, haben die Zentralbanken bereits angekündigt und die Märkte auf eine längere Periode restriktiver Geldpolitik eingestellt – auch um die Gefahr steigender Inflationserwartungen im Keim zu ersticken. Zu sehr schmerzt noch die Erfahrung des harten Disinflationsprozesses in den USA unter Paul Volcker.
Die jetzige Zinswende kam so schnell, dass das Finanzsystem kaum Zeit zur Anpassung hatte – zumal Zentralbanken die Erwartung geschürt hatten, dass sie auf absehbare Zeit gar nicht nötig sei. Nun aber drohen auf der Aktivseite massive Wertberichtigungen bei den zuvor stark inflationierten Vermögenswerten – und womöglich eine dadurch ausgelöste Bilanzkrise.
Zentralbanken bevorzugen aus diesem Grund den allmählichen, lange vorbereiteten Kurswechsel. Dafür aber ist nun – auch aus eigenem Verschulden – keine Zeit mehr. Jetzt, wo das engere geldpolitische Mandat plötzlich wieder greift, geht die Stabilitäts- und Haftungsverantwortung wieder auf einzelwirtschaftliche Akteure zurück – wo sie eigentlich hingehört. Womöglich kommt die Wende aber zu spät, denn nun entsteht nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS paradoxerweise eine noch größere Bank mit noch größerem Risiko.
Große Banken können nur schwer gerettet werden
Vom Risikoforscher Taleb stammt die wunderbare Beobachtung, dass in der Natur alles das, was zu groß geworden ist, immer die Fähigkeit verloren hat, plötzliche Veränderungen der Rahmenbedingungen zu überleben. Er leitet aus diesem Stabilitätsargument das Subsidiaritätsprinzip ab. „Too big to fail“ könnte also bald zu „too big to be saved“ werden. Dann haben wir ein richtiges Problem. Ein Problem, dessen Anfänge in die Vergangenheit zurückreichen – bis ins Jahr 2008.
„Whatever it takes“, der berühmte Satz des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi, charakterisiert wohl am besten den Politikansatz, der seit dem Jahr 2008 vorherrschte, als die Lehman-Pleite die Welt in den Abgrund zu stürzen drohte: Retten, als gäbe es kein Morgen. In einem Fiatgeldsystem kann eben nur die Zentralbank als Lender-of-last-resort in die ultimative Bresche springen. Unbedingter Gläubigerschutz aber ist auf Finanzmärkten, auf denen – anders als auf Gütermärkten – im Wesentlichen Erwartungen und Risiken gehandelt werden, fatal. Denn er setzt aus, was die Finanzmärkte eigentlich leisten sollen: einen effizienten, vorausschauenden und marktbasierten Umgang mit Risiken.
Die Politik kann Risiken nicht übernehmen
Gerade auf den Finanzmärkten ist die Politik des Whatever-it-takes kurzfristig verlockend und bequem, langfristig aber teuer und gefährlich, weil sie die Illusion nährt, Unsicherheit und Risiko als Grundtatbestand der Welt und des Wirtschaftens könnten politisch einfach übernommen werden. Das ist in hohem Maß sozial ungerecht und allokativ ineffizient, war aber lange der Fall. Der Krisenfall wurde zum Normalfall und Dauerzustand. Und genau hier kommt die Politik ins Spiel. Durch die Aussetzung von Marktmechanismen haben sich bequeme, aber gerade deshalb so gefährliche Abhängigkeiten zwischen Bankenstabilität, Staatsschulden-Tragfähigkeit und Geldpolitik gebildet, die gerechtfertigt waren, als eine Kernschmelze der Finanzmärkte die Weltwirtschaft in ein Jahrzehnt tiefer Depression zu reißen drohte. Nun aber sind sie selbst zur größten Gefahr für die nächste Banken- und Finanzkrise geworden. Der Weg, der damals eingeschlagen worden war, wurde seitdem nie mehr verlassen und führte immer tiefer in die wechselseitige Abhängigkeit. Nun, da die Abhängigkeit schon systemisch ist, wird die Loslösung von ihr selbst zum Risiko.
Der gegenwärtige Zustand der internationalen Finanzmärkte bleibt über die kurzfristige Lösung mit der Credit Suisse hinaus angespannt. Die Weltwirtschaft hat sich geo- und industriepolitisch stark und abrupt verändert. Wir stehen am Beginn eines neuen geopolitischen Regimes der Weltwirtschaft, aber auch in den nationalen Volkswirtschaften vor großen industriepolitischen Veränderungen.
Es werden sich unabwendbar sektorale Ungleichgewichte zwischen Konsum und Investition, außenwirtschaftlichen Überschüssen und Defiziten und Gegenwart und Zukunft bilden, was wiederum zu fundamentalen, aber auch monetären Anpassungen führen muss. Es ist interessant und kein Zufall, dass in den letzten Jahren sowohl die österreichische Konjunkturtheorie, die sich wesentlich auf die Idee von Ungleichgewichten stützt, und die postkeynesianische Finanztheorie in Gestalt der Modern Monetary Theory nahezu zeitgleich eine Renaissance erlebt haben. So finanziert die Politik die Wirtschaft Beide Theorien werden in ihren Erklärungen und Limitationen in der politischen Debatte eine wichtige Rolle spielen und wahrscheinlich sogar aufeinanderprallen. Hintergrund ist die politische Absicht, den hohen Investitionsbedarf und die ökonomische Realität zu finanzieren, in der Finanzierungsspielräume kleiner werden, weil das Potenzialwachstum sinkt und gleichzeitig die Verteilungskonflikte zunehmen.
Häufig wird argumentiert, die grüne Transformation der Wirtschaft könne einen neuen Boom auslösen. Richtig ist, dass sie durch den Schutz der Lebens- und Produktionsbedingungen unsere langfristigen Konsummöglichkeiten erhält. Grüne Investitionen haben jedoch keinen Kapazitätseffekt: Wir können zwar zukünftig klimaneutral, aber nicht unbedingt mehr produzieren.
Die Transformation geht also makroökonomisch mit einem Entzug an heutigen Konsummöglichkeiten einher, ohne dass dem ein Mehrkonsum in Zukunft gegenübersteht. Das ist der Grund dafür, dass grüne Investitionen heute nach wie vor nur bedingt kapitalmarktfähig sind.
Deglobalisierung verteuert Produktion
Die makroökonomischen Konsumansprüche werden indes eher steigen, denn die lange Phase des volkswirtschaftlichen Sparens geht zu Ende. Das demografische Entsparen hat bereits begonnen und ein langer realer Kreditzyklus befindet sich damit am Wendepunkt. Die von der Politik versprochenen Investitionen in die Transformation werden in der Summe so hoch sein, dass die Rechnung nicht aufgeht, ohne dass die Politik die Illusion fallen lässt, dies alles sei zum Nulltarif zu haben. Hinzu kommt die Tendenz einer Deglobalisierung, die die Produktion massiv verteuert und Konsummöglichkeiten beschränkt.
Die immergleiche ordnungspolitische Lehre aus der Vergangenheit und für die Zukunft lautet: Politik, Finanzierung und Realität lassen sich nicht unabhängig voneinander denken. Banken und Finanzmärkte sollen helfen, durch Fristen- und Risikotransformation die realwirtschaftlichen Prozesse effizienter zu machen. Dafür müssen sie aber mit der Realität konfrontiert werden. Letztlich führt fast immer eine politische Überforderung der ökonomischen Realität zu Finanzkrisen.
Dieser Artikel erschien am 27.03.2023 unter folgendem Link:
https://www.dasinvestment.com/bankenkrise-finanzkrise-inflation-zinsen-notenbanken/
Wichtiger Hinweis: Bei dem verfassten Text handelt es sich um die Meinung des Autors. Er stellt weder eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung oder eine Beratung dar. Beratungen können immer nur persönlich geschehen. Wenn Sie eine Beratung wünschen, nutzen Sie bitte eine der Kontaktmöglichkeiten.